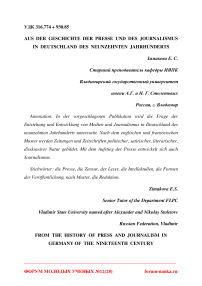Aus der geschichte der presse und des journalismus in deutschland des neunzehnten jahrhunderts
Автор: Zimakova E.S.
Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka
Статья в выпуске: 12-1 (28), 2018 года.
Бесплатный доступ
In der vorgeschlagenen Publikation wird die Frage der Entstehung und Entwicklung von Medien und Journalismus in Deutschland des neunzehnten Jahrhunderts untersucht. Nach dem englischen und französischen Muster werden Zeitungen und Zeitschriften politischer, satirischer, literarischer, disskussiver Natur gebildet. Mit dem Aufstieg der Presse entwickelt sich auch Journalismus.
Die presse, die zensur, der leser, die intellektullen, die formen der veröffentlichung, nach muster, die redaktion
Короткий адрес: https://sciup.org/140289775
IDR: 140289775
Текст научной статьи Aus der geschichte der presse und des journalismus in deutschland des neunzehnten jahrhunderts
Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н. Г. Столетовых
Россия, г. Владимир
Annotation. In der vorgeschlagenen Publikation wird die Frage der Entstehung und Entwicklung von Medien und Journalismus in Deutschland des neunzehnten Jahrhunderts untersucht. Nach dem englischen und französischen Muster werden Zeitungen und Zeitschriften politischer, satirischer, literarischer, disskussiver Natur gebildet. Mit dem Aufstieg der Presse entwickelt sich auch Journalismus.
Stichwörter: die Presse, die Zensur, der Leser, die Intellektullen, die Formen der Veröffentlichung, nach Muster, die Redaktion.
Senior Tutor of the Department FLPC
Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs
Russian Federation, Vladimir
FROM THE HISTORY OF PRESS AND JOURNALISM IN GERMANY OF THE NINETEENTH CENTURY
Annotation. The proposed publication deals with the formation and development of media and journalism in nineteenth-century Germany. According to the English and French model, Newspapers and magazines of political, satirical, literary, and discussion character are formed. With the rise of the press develops and journalism.
Die Geschichte der Presse, der Zeitungen und politischen Zeitschriften in Deutschland, ist die Geschichte der Pressefreiheit wie eine Geschichte sich wandelnden Zeitungsstils. In der napoleonischen Zeit waren die Zeitungen ganz an Paris oder in Wien und Berlin, an die Appeasemmentpolitik der Regierungen gebunden. Eine unabhängige politisch engagierte Meinungspresse hat sich zuerst während der Freiheitskriege etabliert. Am berühmtesten war Joseph Görresۥ nationaldemokratischer „Rheinischer Merkur“ in Koblenz (1814), den Napoleon, modern wie er war, als seine eigene „Großmacht“ einschätze – ein Blatt alle 2 Tage auf 4 Seiten!; das Blatt ist, wie andere vergleichbare Zeitschriften, nach 1815 der Restauration zum Opfer gefallen. Karlsbader Beschlüsse uns Zensur, das Verbot kritischer Meinungsäußerung bestimmten das Schicksal der Tagespresse, das Leiden der liberalen Publizisten. Man muss hier freilich Einschränkungen machen. Zensur und Zensurpraxis hatten strenge und weniger strenge Phasen, hatten Lücken, und es gab die Unterschiede zwischen den deutschen Staaten, das Ausweichen in immer andere Publikationsformen, Zeitschriften etwa, die Emigration und den Schmuggel. Der „Polizeistaat“ war, verglichen mit unserem Jahrhundert, sehr unvollkommen, und zwischen Presse und Zensur gab es ein ständiges Auf und Ab. Die Zensur hat Oppositionellen juristisch und menschlich zu Opfern gemacht, sie hat die kontinuierliche freie Aussprache der Öffentlichkeit verhindert. Die politischen Parteien haben sich um Presseorgane herum etabliert.
Die Tageszeitungen der Restaurationszeit, neben offiziellen Hof- und Staatsorganen und den auf einem staatlichen Anzeigenmonopol beruhenden Anzeigern, den sogenannten „Intelligenz“blättern, waren zumeist politisch neutral, ja abstinente, „farblose“ Nachrichtenblätter, zunächst auf ihren Lokalbereich begrenzt. Nur die vom Verleger Cotta in Augsburg herausgegebene „Allgemeine Zeitung“, reich an Inhalt, in einem ruhig objektivierten Stil, auf einem keineswegs unprofilierten Kurs der Mitte geschrieben.
1830\31 und dann wieder seit Ende der 30er Jahre kommt es, vom Jungen Deutschland und den Junghegelianern vor allem betrieben, zu einer ansteigenden Welle immer neuer und wechselnder publizistischer Neugründungen der Opposition – bis zu den „Halleschen Jahrbuchern“ (18381843) oder der „Rheinischen Zeitung“ (1842\43), die von rheinischen Grossbürgern finanziert und von radikalen Intellektuellen wie Karl Marx geschrieben wurde. Und auch am Rande der Politik nimmt die Zahl von Zeitschriften und Journalen erheblich zu.
Die Revolution ist ein Jahr der alten wie neuen Zeitungen. Politik geht über Zeitungen, und sie werden jetzt von Massen gelesen. Diese Erfahrung war auch nach 1848 nicht mehr fortzuwischen. Der Staat konnte über Kautionen, Konzessionen und Gebühren, mit Polizei und Gerichten die Presse bedrängen – wie in den 50er Jahren -, die Zensur aber wurde nicht mehr eingeführt. Zahl und Auflagenhöhe nahmen weiter zu; in Bremen z. B. stieg das Verhältnis von Zeitung zu Bevölkerung von 1:25 (1841) auf 1:5,6 (1865); in Berlin erschienen 1862 32 Zeitungen, 6 davon zweimal täglich, und 58 Wochenblätter. Auch der Umfang wuchs:; und die Differenzierung nach Resorts; Wirtschaft; Feuilleton, bis zum Fortsetzungsroman, und, nach dem Fortfall des Staatsmonopols, die Anzeigen nahmen zu. Schließlich dehnt sich das Zeitungswesen seit den 50er\60er Jahren mit den Kreis- und Kleinstadtzeitungen in die Provinz und auf das Land aus. Es ist die Presse gewesen, die das Land langsam in das „literarische“ Leben, in sozialen Wandel, Politik und nationale Gesellschaft eingegliedert hat. Ebenso wichtig für die Entwicklung bürgerlicher Politik wie Kultur ist die Entwicklung eines – notwendigerweise – nationalen Zeitschriftwesens, vielfach auch über Lesezirkel weiter verbreitet.
Die Leserschaft verbreitet sich weit über den Kreis Leser der Aufklärungszeitschriften und der klassisch-romantischen Literaturzeitschriften hinaus. Dazu gehören politische Zeitschriften der politischen Klasse, in der sich die verschiedenen Richtungen diskutierend artikulieren und sammeln – bei den Liberalen etwa neben den erwähnen, jetzt von Gustav Freytag geleiteten “Grenzboten“, die berühmten „Preußischen Jahrbücher“. Dazu gehören dann, nach belletristischen Unterhaltungsblättern des Vormärz, die politisch-kulturellen Revuen – wie „Westermanns Monatshefte“ oder, „Cottas Morgenblatt für die gebildeten Stände“; gehören die satirischen Blätter nach englischem und französischem Vorbild; gehören die zahllosen Organe für jedes Fach, jeden Beruf, jedes Spezialgebiet. Diese neuen Zeitschriften waren unterhaltend, literarisch, informativ – über Natur, fremde Länder, Geschichte -, gemütvoll und keineswegs unpolitisch, sondern vor allem liberal und national und integrativ, wenn auch harmonisierend und ein wenig idyllisch und sentimental, ein Phänomen der entstehenden bürgerlich-kleinbürgerlichen Massekultur, und nach 1871 mehr als vorher ihrer Traumwelten und ihrer Surrogate, keineswegs besonders deutsch, sondern eben bürgerlich und menschlich.
Die Journalisten, eine neue Gruppe, entsteht mit Aufstieg der Presse. Die Journalisten identifizieren sich gern mit der Aufgabe der Presse. Im Vormärz werden die nebenberuflichen von den hauptberuflichen Redakteuren verdrängt; die Mehrheit ist noch akademisch gebildet und promoviert – der damalige Zeitungsbetrieb verlangte die Beherrschung lebender Fremdsprachen -, viele auch mit gelehrten universitären oder literarischen Ambitionen, mit anderer Berufserfahrung, der Typ des philosophisch-politischen Intellektuellen. Nach der Revolution gehen die „Promovierten“, die „Philologen“, die Berufswechsler zurück; ausgebildete Juristen und Ökonomen und Leute, die bei der Zeitung anfangen, spielen eine größere Rolle. Der Beruf professionalisiert sich: der Berichterstatter gewinnt neben dem Meinungsmacher, der Lokalreporter und der Nachrichtenredakteur neben dem Leitartikler Raum. Für die politisch engagierten und ehrgeizigen Angehörigen der beamteten, der akademischen, der freien Intelligenz spielte der „nebenberufliche“ Journalismus noch eine große Rolle; die journalistischen Fähigkeiten von Konservativen, Liberalen, Sozialisten waren die Basis politischer Karrieren.
Nach 1830 werden das Leben und die Literatur und andere Bereiche mehr politisiert, den philosophisch-politischen Norman unterstellt; neben die Männer der Kirche und der Universität, die Beamten und die Dichter treten die Journalisten als Formulierer des Allgemeinen, als Protagonisten der Veränderung, als Avantgarde. Der Meinungsjournalismus war der Versuch, Ideen zu propagieren und Anhänger zu werden. Jedenfalls waren Parteinahme, Urteil, kritische Reflexion für den Journalisten typischer als Berichterstattung und Information; die veröffentlichen Meinung nur zum Teil identisch; bestimmte Realitäten, wie das Land oder das katholische Volk, waren fast ausgeblendet, andere – wie die kirchlichen Aufklärungsgruppen der 40er Jahre – überbelichtet.
Zur Lesekultur gehören Zeitungen und Zeitschriften. Die Deutschen werden in unserem Zeitraum endgültig und weit mehr noch als vorher zu einem Volk von Zeitungslesern – auch die Kleinbürger, die Bauern, die Arbeiter, auch die Frauen. Das Zeitungslesen wird ein tägliches Geschäft, es wird wichtig, ja es wird, ein Stück weit, bewußtseins – und verhaltensprägend; die Presse wird ein Zusammenhang, ein System, und sie wird eine Macht.
Liste der verwendeten Literatur:
-
1. Nipperdey Th. Deutsche Geschichte 1866-1918. Erster Band. Verlag C.H. Beck München, 1998, 885 c.
-
2. Koszyk K. Deutsche Presse im 19. Jahrhundert. Geschichte der deutschen Presse Teil 2. 1966.
-
3. Fischer H.–D. Handbuch der politischen Presse in Deutschland 1480-1980. 1981.
-
4. Fischer H.–D. Deutsche Zeitungen des 17. Bis 20. Jahrhunderts. 1972.
-
5. Wolter H.–W. Generalanzeiger – das pragmatische Prinzip. Zur Entwicklungsgeschichte und Typologie des Pressewesens im späten 19. Jahrhundert mit einer Studie über die Zeitungsunternehmungen Wilhelm Girardets (1838-1918). 1981.
-
6. Engelsing R. Massenpublikum und Journalistentum im 19. Jahrhundert in Nordwestdeutschland. 1966.
Список литературы Aus der geschichte der presse und des journalismus in deutschland des neunzehnten jahrhunderts
- Nipperdey Th. Deutsche Geschichte 1866-1918. Erster Band. Verlag C.H. Beck München, 1998, 885 c.
- Koszyk K. Deutsche Presse im 19. Jahrhundert. Geschichte der deutschen Presse Teil 2. 1966.
- Fischer H.-D. Handbuch der politischen Presse in Deutschland 1480-1980. 1981.
- Fischer H.-D. Deutsche Zeitungen des 17. Bis 20. Jahrhunderts. 1972.
- Wolter H.-W. Generalanzeiger - das pragmatische Prinzip. Zur Entwicklungsgeschichte und Typologie des Pressewesens im späten 19. Jahrhundert mit einer Studie über die Zeitungsunternehmungen Wilhelm Girardets (1838-1918). 1981.
- Engelsing R. Massenpublikum und Journalistentum im 19. Jahrhundert in Nordwestdeutschland. 1966.