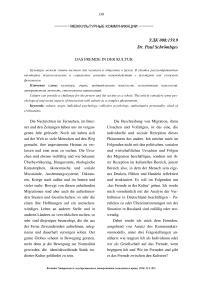Das fremde in der kultur
Автор: Schrmbges Paul
Журнал: Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права @vestnik-ael
Рубрика: Межкультурные коммуникации
Статья в выпуске: 3, 2018 года.
Бесплатный доступ
Culture can provide a challenge for the person and the society as a whole. The article considers some psychological and social aspects of interaction with culture as a complex phenomenon.
Culture, angst, individual psychology, collective psychology, authoritative personality, clash of civilizations
Короткий адрес: https://sciup.org/143165987
IDR: 143165987
Текст научной статьи Das fremde in der kultur
Die Nachrichten im Fernsehen, im Internet und den Zeitungen haben uns im vergan-genen Jahr gefesselt: Noch nie haben sich auf der Welt so viele Menschen auf den Weg gemacht, ihre angestammte Heimat zu ver-lassen und eine neue zu suchen. Die Ursa-chen sind ebenso vielfältig und wie bekannt: Überbevölkerung, Hungersnöte, ökologische Katastrophen, ökonomische und soziale Missstände, Ausbeutungssysteme, Diktatu-ren, Kriege nach außen und im Innern und vieles mehr. Bewegt von diesen anhaltenden Migrationen sind aber auch die aufnehmen-den Staaten und Gesellschaften: so sehr die einen ihre Hoffnungen auf ein menschen-würdiges Leben an anderer Stelle und in anderen Ländern zu verwirklichen suchen, so sehr sind diejenigen beunruhigt, die die aus der Ferne Zuwandernden aufnehmen, integ-rieren und dauerhaft versorgen sollen. Der ganze Globus scheint in Bewegung geraten, mehr denn je die Bewegung zur Normalität geworden, die identitätsstiftende Statik tra-dierter Kultur gefährdet zu sein.
Die Beschreibung von Migration, ihren Ursachen und Vollzügen, ist das eine, die individuelle und soziale Rezeption dieses Phänomens das andere. Ich möchte mich im Folgenden nicht mit den politischen, sozialen und wirtschaftlichen Ursachen und Folgen der Migration beschäftigen, sondern mit ih-rer Rezeption im kulturellen Bereich, jenem Bereich also, in dem der Mensch sein eige-nes Denken, Fühlen und Handeln reflektiert und strukturiert. Es soll im Folgenden um ‚das Fremde in der Kultur‘ gehen. Ich werde mich vornehmlich mit der Analyse der Ver-hältnisse in Deutschland beschäftigen – Pa-rallelen zu oder Übereinstimmungen mit der Situation in Russland sind zufällig oder not-wendig.
Dabei werde ich mich dem Fremden, ausgehend von Ansatz des Kommunikati-onsmodells, unter drei Fragestellungen an-nähern: wie reagiere Ich als Individuum oder wir als Gesellschaft auf das Fremde, wem begegnen Ich und Wir im Fremden und gibt es das Fremde zwischen den Kulturen?
-
I. Das Fremde im Ich
Zunächst zur Individualpsychologie: Die Angst von Mensch und Tier hat evolutions-geschichtlich, wie die Verhaltensforschung uns lehrt, eine wichtige Funktion als ein die Sinne schärfender Schutzmechanismus, der in tatsächlichen oder vermeintlichen Gefähr-dungssituationen ein angemessenes Verhal-ten einleitet, etwa die Flucht, das Auswei-chen vor Situationen, Panik, Wut oder Aggression. Die Psychologie hat seit mehr als einem Jahrhundert dieses Phänomen intensiv erforscht. Für unseren Zusammenhang be-deutend ist, dass jeder Mensch von Geburt an eine ihm spezifische Angstdisposition mitbringt, die sich durch lebenslange Lern-prozesse verändern und in gewissem Maße auch steuern lässt. Siegfried Warwitz (2016) hat in seinen psychologischen Forschungen die ‚Wagnisbereitschaft‘ des Menschen un-tersucht; der Wagnis/dem Mut kommt nach Warwitz bezüglich der Handlungsbereit-schaft des Menschen grundsätzlich eine An-triebsfunktion zu, der Angst eine Bremsfunk-tion. Er hat dabei 8 typische Einstellungsten-denzen des Menschen zur Angst systemati-siert, von denen 7 eher passive Verhaltens-muster aufweisen. Für unseren Kontext xe-nophobischer Verhaltensstrukturen sticht – als Ausnahme - das Heroisierungsverhalten hervor: es nimmt als einiges Verhaltensmus-ter die emotionale Befindlichkeit der Angst an, sucht sie sogar und empfindet dabei ein gewisses Heroentum. Die Angst wird so gewisser Maßen zum Stimulus für Aggression zur eigenen Angstbewältigung. Dieses Verhalten ist in Deutschland derzeit oft bei ausländer- oder migrationsfeindlichen De-monstrationen bis hin zum aggressiven Ein-zelverhalten zu beobachten und speist sich
aus unterschiedlichen individuellen oder kom-munitarischen bzw. politischen Ängsten – stellt also keine rationale Reaktion in der Begegnung mit dem Fremden dar, sondern ist Produkt eines Angstverhaltens.
In politischen Diskussionen in Deutschland werden häufig Erklärungsmuster zitiert, die die Angst vor dem Fremden als ein ‚na-türliches‘ menschliches Grundmuster aus-weisen. Ein Ansatz versteht die Angst des Ich vor dem Fremden als eine genetisch fi-xierte Tendenz, die sich aus den elementaren Grundformen der Solidarität in verwandt-schaftlichen Kleingruppen in der Frühzeit der Menschheitsgeschichte herausgebildet habe und im Verlaufe der Menschheitsent-wicklung zum festen Grundmuster des Men-schen geworden sei. Hinreichende empiri-sche Belege für diese Annahme gibt es indes nicht. Formallogisch bleibt zudem unklar, wie bei gleicher genetischer Grunddispositi-on unterschiedliche Reaktionen auf Fremdwahrnehmungen erklärbar sein könn-ten. Eine historisch geronnene Erklärung lieferte dagegen Theodor W. Adorno, der im Rekurs auf die Erfahrungen mit dem deut-schen Nationalsozialismus die Theorie der autoritären Persönlichkeit entwickelte (1950) [1]. Ihr zufolge bildet die Fremden-feindlichkeit mit antisemitischen, konserva-tiven und autoritären Grundhaltungen ein Syndrom, das für den Typus der autoritären Persönlichkeit charakteristisch ist. Insbeson-dere eine strenge, durch harsche Disziplin und rigider Unterdrückung sexueller Bedürf-nisse oder aggressiver Triebe geprägte Er-ziehung begünstige die Entwicklung einer autoritären Persönlichkeit: Sie weist ein schwaches Ego auf und verdeckt die eigenen Unzulänglichkeiten und Unsicherheiten durch übertriebene Unterwürfigkeit gegen-über Autoritäten und Abwehr alles Fremden und ‚Abnormalen‘. Adornos Hypothese ist historisch plausibel, aber sozialpsycholo-gisch kaum belegbar. Vor allem unterstellt sie einen weitgehend unbewusst verlaufen-den ‚Verdrängungsmechanismus‘ als Mas-senphänomen. Unklar bleibt zudem, wieso sich individuelle Unzufriedenheit und Frustration ausgerechnet gegen ‚Fremde‘ richten sollte und nicht gegen die Verursacher des autoritären Regimes. Anzumerken bleibt schließlich, dass es in Westeuropa kein auto-ritäres Regime gibt, das diesen Erklärungs-ansatz rechtfertigen würde. Man darf folglich festhalten, dass sich die soziale Verbreitung und aktuelle Wiederkehr fremdenfeindlicher Tendenzen nicht mit individuellen Frustrations- und Deprivationsdispositionen begrün-den lassen.
Ausschlaggebender scheinen vielmehr sozialstrukturelle und soziokulturelle Fakto-ren zu sein. Gerade in und für Deutschland wird von internen und externen Beobachtern oftmals eine kollektive Mentalität ausge-macht, die fremdenfeindliche Tendenzen vor allem mit historischen Entwicklungszusam-menhängen zu erklären versucht: Deutschland sei eine der ‚späten‘ Nationen und stelle nach den Erfahrungen der NS-Zeit eine wei-terhin verunsicherte Nation dar. Dem ist entgegen zu halten, dass sich in Westeuropa gerade auch in ‚gefestigten‘ Nationalstaaten mit langer demokratischer Tradition wie z.B. Frankreich, Großbritannien, Niederlande und Dänemark eine auch parteipolitisch verfes-tigte Abwehrreaktion gegenüber Migranten darstellt. Eine historische Begründung für Fremdenangst und -feindlichkeit ist folglich nicht hinreichend. Heitmeyer (1996) sieht dagegen eine tiefgreifende soziale Integrations- und Desintegrationsdynamik als Ursa-che von Fremdenfeindlichkeit, deren Ursa-chen er in Prozessen funktionaler Differen-zierung, Individualisierung und Enttraditio-nalisierung moderner Gesellschaften vermu-tet. Konkret: In der postindustriellen deut-schen Gesellschaft nehmen die Handlungs-möglichkeiten des Einzelnen deutlich zu, zugleich lösen sich die traditionellen Milieus in Kirche, Gewerkschaft, Politik und Verei-nen zunehmend auf. Aufgrund aufgelöster Familienstrukturen sind traditionelle Bil-dungs- und Karrieremöglichkeiten zuneh-mend gefährdet. Die Verständigungsmög-lichkeiten über gemeinsame Wert- und Normvorstellungen nehmen aufgrund der Individualisierungsprozesse ab und ersetzen alte Gewissheiten nicht. Zentrale gesell-schaftliche Institutionen wie die Parlamente und gewählten Politiker werden aufgrund anhaltender direktdemokratischer Meinungs-bildungsprozesse – nicht zuletzt in den sozia-len Medien – zunehmend paralysiert. Frem-denfeindliche Orientierungen und Handlun-gen beruhten diesem Ansatz zufolge wesent-lich auf gesellschaftlichen Desintegrations-prozessen und eine allgemeine Verunsiche-rung des Einzelnen. Gesucht werden neue Gewissheiten und leistungsunabhängige Zu-gehörigkeitsmöglichkeiten, um zunehmende Handlungsunsicherheiten und Vereinze-lungserfahrungen zu kompensieren. Eine individuelle Sehnsucht nach Verstehensver-einfachung und sozialer Beheimatung bräche sich somit Bahn. So einleuchtend dieser Er-klärungsansatz erscheint, auch er hat Schwachstellen: gerade auf den aktuellen Demonstrationen gegen Ausländer und Flüchtlinge ist erkennbar, dass bei Weitem nicht nur desintegrierte Personen z.B. aus den unteren Schichten ablehnende Verhal-tensweisen gegenüber Ausländern zum Aus-druck bringen und dass zugleich auch nicht alle desintegrierten Personen sich ausländer-feindlich verhalten.
Ein letztes Erklärungsmodell für ein Ver-ständnis des durch das Fremde verängstigten Ich konzentriert seine Ursachenforschung auf die direkte Beziehungsebene zwischen Deutschen und Ausländern, indem es sozial-strukturellen Konstellationen und direkte Interessenskollisionen untersucht. Es gibt einen alten Forschungsansatz, der von ‚ob-jektiven‘ kulturellen Unterschieden zwischen Einheimischen und Ausländern ausgeht und darin den Grund für die Ablehnungstenden-zen in Aufnahmeländern sieht. Eine einfaches Beispiel: ein islamischer Fremder be-grüßt deutsche Frauen nicht mit Handschlag. Wie ist das zu verstehen: als Ablehnung oder Herabwürdigung? Oder ist das ein in seinem Kulturkreis übliches Verhalten? Und wenn es so wäre: wäre das tolerabel? Natürlich weisen die Soziologen zu Recht darauf hin, dass im interkulturellen Kontext Kultur und kulturelle Differenzen nicht unabänderlich sind, sondern als soziale Konstrukte verstan-den werden müssen, deren Interpretations-und Deutungsmuster veränderbar sind und erklärt werden müssen. Zu beobachten ist indes auch, dass in der wechselseitigen Be-gegnung mit dem Fremden auf Seiten der Einheimischen wie der Zuwandernden bislang oft nicht gestellte Fragen nach der eige-nen Identität zu neuen (bzw. alten) Antwor-ten und zusätzlichen Verwerfungen führen. Im genannten Beispiel: welche Rolle spielt die Frau im Islam und was toleriert eine Gesellschaft, die wegen der Menschenrechte von der Gleichberechtigung von Mann und Frau ausgeht? Die Frage nach dem ‚wer bin ich‘ erfährt so eine neue Brisanz, der man mit der Verfestigung in der je eigenen Tradition, Religion und Kultur zu begegnen ver-sucht. Die Begegnung mit dem Fremden führt so zu einer Stärkung des kulturellen Monologs, nicht des interkulturellen Dialogs, kann sogar das wechselseitige ‚Fremdsein‘ verstärken. Ob man dieses Problem individual- oder sozialpsychologisch angeht, ist eher unerheblich, auch, ob man ein unbe-wusstes oder ein missionarisches Auftreten annimmt: der Streit um einander ausschlie-ßende Verstehens-‚Wahrheiten‘ ist ein inter-kulturelles Phänomen seit Jahrhunderten und in den Kriegen der Völker allpräsent. Sehr viel konkreter dagegen ist ein Ansatz, der ethnische und kulturelle Grenzziehungen in erster Linie als Resultat kontroverser Interes-senlagen versteht: über die Verteilung knap-per Güter (oder als knapp angenommener Güter) wie etwa Arbeitsplätzen, Wohnungen, Sozialleistungen. Eine wichtige Rolle spielt in diesem Kontext auch die Bewahrung an-gestammter Privilegien beim Zugang zu staatsbürgerlichen Vorrechten oder wohl-fahrtsstaatlichen Leistungen, nicht zuletzt auch die Sorge, ob das wohlfahrtsstaatliche und demokratische System die kulturelle, soziale und wirtschaftliche Belastung der Zuwanderung erträgt: die Angst vor der Pre-kariatisierung, dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Abstieg, entfaltet eine strei-tige Wirkung. Ob diese Interessenskonflikte tatsächlich vorliegen oder nur als solche wahrgenommen werden oder werden sollen, ist für die Wirkung unerheblich.
Damit bin ich beim letzten Erklärungs-muster für die Deutung der Wirkung des
Fremden im Ich angekommen: dass nämlich die Wahrnehmung und Entstehung von Inte-ressenskollisionen und Fremdenängsten in der Wirkung politischer Propaganda und medialer Desinformation begründet sei. Na-türlich ist eine solche Kausalität grundsätz-lich zu bezweifeln: sie setzte ja die scheinbar bedingungslose Manipulierbarkeit der Be-völkerung voraus. Einzuwenden ist aller-dings, dass das Korrektiv kritischer Journail-le rückläufig ist und der Zugriff manipulie-render Beiträge auf die sozialen Medien qua-litativ wie quantitativ zunimmt. Es erweist sich abermals, dass die Informationsgesell-schaft mehr denn je kritisches Potential bei den Lesern selbst voraussetzt, sie kritische Rezeption indes nicht selbst schafft. Die Bedeutung populistischer Propaganda, breit entfalteter Verschwörungstheorien und sen-sationsheischender Medienberichterstattung für die öffentliche und private Meinungsbil-dung ist folglich nicht gering zu erachten. Gleichwohl bleibt einzuwenden, dass die Wirkung dieser Art Propaganda vornehmlich diejenigen erreicht, die bereits eine tendenzi-ell fremdenfeindliche Grundhaltung aufwei-sen und stetig auf der Suche nach einer Be-stätigung ihrer Annahmen sind.
Auf die Frage, wie sich Unterschiede in der Tendenz zu fremdenfeindlichen Einstel-lungen und Verhaltensweisen aus der Be-gegnung mit dem Fremden psychologisch oder soziologisch erklären lassen, gibt es offensichtlich keine einfachen Antworten. Ein umfassender Verstehens- und Deutungs-ansatz der politologischen Forschung ist nicht in Sicht, den diejenigen, die für politi-sche Maßnahmen zuständig und verantwort-lich sind, indes zu Recht erwarten dürfen. Für die politische, insbesondere kultur- und sozialpolitische Praxis dürften dabei jene Erklärungsansätze, die sich auf der Ebene der psychologischen oder soziologischen Makrotheorie bewegen, eher weniger ziel-führend sein. Als Grundlage operativer Maßnahmen scheint die Analyse konkreter sozialstruktureller Bedingungen und die dadurch geprägten Interessenlagen und Deu-tungsmuster zielführender zu sein. Fremden-feindlichkeit dürfte man in diesem Sinne als soziales Phänomen verstehen, das diejenigen einer tatsächlichen oder gedeuteten Konkur-renzsituation aussetzt, die diese Konkurrenz am wenigsten bestehen können oder meinen, bestehen zu können. Die Betätigungsfelder des Politischen sind somit ersichtlich: Bil-dung, soziale Kommunikation, kritische Re-flektion des Gehörten und Gelesenen, Kon-stituierung persönlicher und medialer Erfah-rungen im Umgang mit dem Fremden, Formung sozialer Bezugsfelder und Milieus, Begründung sozialer Anerkennung, wirt-schaftliche Sicherung des sozialen und per-sönlichen Lebens sind Arbeits- und Themen-felder des Politischen, die es dem Einzelnen ermöglichen, dem Fremden ohne Angst zu begegnen.
-
II. Das Fremde im Du
Was für das Individuum gilt, gilt auch für die Gesamtheit einer Kultur. Der heute ge-meinhin verwandte Kulturbegriff geht auf den Philosophen und Dichter Johann Gottfried Herder zurück, der Kultur als ein Ensemble verschiedener Merkmale versteht: Sprache, Denken, Wahrnehmen, Habitus, Institutionen, und materieller Produkte wie Kunst, Architektur, Musik. Insgesamt bilden sie eine Einheit und organische Ganzheit, eben die Kultur. Diese Kultur versteht Herder als die Identität eines Volkes bzw. einer
Nation. Im Unterschied zu Herder versteht man heute Kultur nicht als etwas Beständi-ges, sondern als eine veränderbare und sich verändernde Größe. Zweifelsfrei ist die deutsche oder eine andere Kultur des Jahres 2016 eine andere als die des 18. Jahrhunderts. Kulturen verändern sich: durch Entwicklun-gen von innen her: durch Philosophie, Na-turwissenschaften und Technologie, durch Entwicklungen in Literatur, Kunst, Musik und Architektur, in Volkswirtschaft und im Sozialwesen, aber auch durch Adaptionen aus anderen Kulturen. Dies gilt im Besonde-rem in der global zunehmend vernetzten Welt des 20. und 21. Jahrhunderts. Beinahe alle Kulturen der Gegenwart sind folglich durch Synkretismus gekennzeichnet. In der postindustriellen Gesellschaft stellt sich die Kultur eines Kulturraumes zudem auch als in sich hoch differenziert dar: Kultur kann im 21. Jahrhundert kaum noch an ein Volk, eine Nation oder einen Sprachraum gebunden werden. Sie besteht in sich vielmehr aus ver-schiedenen Teilkulturen, Subkulturen, Milieus oder Lebenswelten, die zudem eine Schichtung aus verschiedenen kulturellen Ebenen und von transnationalen (z. B. Rockmusik, Weltreligionen) oder auch regi-onalen Strömungen und Elementen aufwei-sen können. Kultur ist demnach ein dynami-sches Ganzes, ein Diskursfeld, in dem Deu-tungsmuster, Artikulationsformen, Werte, Normen und Traditionen ständig neu disku-tiert werden und vorläufige Gültigkeit erlangen. In diesem Sinne ist die Kultur ein Dia-lograum, der im Dialog beständig mutiert. Eines ist sie sicher nicht mehr: ein fest um-rissenes Etwas, das uns das Andere und das Fremde zweifelsfrei definieren lässt.
Gleichwohl verbleibt der Kultur eines
Landes, eines Sprachraumes oder einer Eth-nie eine bedeutende Orientierungsfunktion, sowohl auf der Ebene makrosozialer Gebilde wie Nationen, Gesellschaften etc., wie auch auf der Ebene kleinster sozialer Einheiten wie Familien, Freundeskreise, Vereinigun-gen usw. Kultur ist nicht nur das, was wir als Hochkultur bezeichnen und über ihre Kon-kretisierungen definieren, sondern auch All-tagskultur: ein System von Bedeutungen, von überkommenen Vorstellungen und sym-bolischen Formen, in das die Menschen hin-einwachsen und enkulturiert werden, mit Hilfe dessen die Menschen sich orientieren, sich ausdrücken, miteinander kommunizie-ren und ihr Wissen und ihre Einstellungen zum Leben mitteilen, erhalten und weiter-entwickeln: Sprache, Regeln, Werte, Rituale, Gestik, Mimik, Kleidung, Lebensstile. Kul-tur ist in diesem Sinne nicht nur ein Produkt, sondern auch ein ‚Verb‘, etwas, das man tut und lebt. In dieser Vielschichtigkeit wird Kultur als existentiale Daseinsdimension des Menschen deutlich: ohne Kultur gibt es kei-ne gemeinschaftliche Lebensform des Men-schen.
Was vor diesem Hintergrund als das Fremde wahrgenommen wird, hängt demzu-folge von der jeweiligen Gesellschaft oder Person ab, ihrer Situation und Selbstdefiniti-on. Das als fremd Wahrgenommene ändert sich in dem Maße, in dem die eigene Kultur sich verändert. Vor allem ist das Fremde keine absolute Größe, keine Eigenschaft des Fremden, sondern stellt eine Beziehungsaus-sage des Bezeichnenden über den oder das Bezeichnete/n dar. Der Fremde ist nur in der Fremde fremd, weil er dort in anderen und neuen sozialen und individuellen Bezügen steht. Andersartigkeit – wie z.B. eine andere
Hautfarbe oder Rasse - ist in diesem Zu-sammenhang lediglich ein Indikator, sie sagt zunächst nichts über die Fremdartigkeit des Wahrgenommenen selbst aus: das Fremde definiert erst sich vor dem Hintergrund des eigenen Selbst, des individuellen wie des gesellschaftlichen, und verändert sich mit dem Selbst.
Damit ist eine zweite wesentliche Dimension im Umgang mit dem Fremden auf-geworfen: die ethische Qualität, die in der interkulturellen Begegnung unabweisbar enthalten ist. Zunächst ist es ja so, dass jede Kultur für sich einen Universalanspruch er-hebt und am Fremden auch die eigene Identi-tät entwickelt. So haben die Griechen schon vor mehr als 2000 Jahren für die Nicht-Griechen die Bezeichnung des Barbaren geprägt, desjenigen, der nicht ihre Sprache spricht und deshalb auch über keine Kultur verfüge. Und auch die europäische Kultur hat seit Jahrhunderten den Mythos des Fremden gepflegt, indem sie den Fremden zum Problem stilisierte, in Afrika, Asien und Amerika, und einen globalen Kolonialismus entwickelte. Darin manifestiert sich eine anthropologische Reduktion des Menschen, die notwendig eine Ver- und Entfremdung des kulturell Anderen zur Folge hat. Die Aberkennung der vollmenschlichen Qualität des Fremden, die Entmenschlichung des Fremden bedeutet die Verdrängung der Hu-manität in der Betrachtung des Fremden. Vor allem Lévinas hat diese in der europäi-schen Geschichte seit Jahrhunderten gepfleg-te Übereinstimmung von (Selbst)Bewusstsein und Gegenstand kriti-siert, die den Fremden nicht als den Gleichen wahrnimmt. Lévinas entwirft in der Folge eine ‚Ethik der Demut‘ gegenüber dem An- deren, eine Ethik der passiven Offenheit und demütigen Hingebung, die in der aktuellen Krise der europäische Moderne jede Art von Determinismus und Universalismus zur Ein-verleibung des Anderen und zur gewaltsa-men Integration des Fremden unterbinden will. Waldenfels hat in diesem Sinne vom Niemandsland der Interkulturalität gespro-chen, in dem man sich mit einem Grenzver-halten bewegt, das sich auf Fremdes einlässt, ohne es dem Eigenen gleichzumachen oder es einem Allgemeinen zu unterwerfen. Diese zunächst praxisfern erscheinenden Grund-satzbemerkungen aus der philosophischen Ontologie tragen konkrete Konsequenzen in sich: in der Begegnung der Kulturen geht es nicht nur um Reziprozität, Symmetrie und Gleichheit, sondern auch um die Frage, ob und wie der Anspruch des Fremden im eige-nen Denken und Handeln mitgedacht werden kann.
Damit ist ein letzter Gedanke in diesem Zusammenhang unausweichlich: der Aspekt des Kulturrelativismus. Der Kulturrelativis-mus entfaltet seine Sprengkraft insbesonde-re, indem er ethische Festlegungen auf den Gültigkeitsbereich einer Kultur beschränkt. Ein Beispiel dazu: Auf einem Kongress trug eine französische Ethnologin vor (Nussbaum 1993), dass die Einführung der Pocken-schutzimpfung in Indien durch die Engländer den uralten Kult von Sittala Devi ausgerottet habe, den Kult der Götter, die man anzube-ten pflegte, um die Pockenerkrankung abzu-wenden. Hier liege ein Beispiel für westliche Missachtung vor. Auf den Einwand, es sei doch besser gesund als krank zu sein, kam die Antwort: es sei die westliche Medizin, die die Dinge binär auffasse, man könne Krankheit nicht einfach der Gesundheit und
Tod nicht einfach dem Leben entgegenset-zen. In der Frage des Kulturrelativismus einbezogen ist somit der eben ausgeführte Komplex des Miteinanders der Kulturen ‚auf Augenhöhe‘ ebenso wie der Aspekt universal gültiger Normen jenseits der Einzelkultu-ren. Wir leben in einer Zeit, die ja gerade das Menschenrechts- und Demokratieverständnis der westlichen Welt als eine Partikularkultur deutet und im weltpolitischen Miteinander zu einer postkolonialen Frage erhebt. Wenn jeder Kulturanspruch gleich gültig ist, könnte das Miteinander der Kulturen nur noch auf der Koordinierungskompetenz vormorali-scher Rationalität gegründet werden. Ein Blick auf die aktuelle weltpolitische Lage verdeutlicht, dass ein friedliches Miteinander der Kulturen indes auch Regeln des Diskur-ses – also normative Setzungen – voraussetzt und zugleich die je eigene Realitätssicht einer Kultur grundsätzlich anerkennt. Wieweit die Wahrnehmungen des je Anderen wech-selseitig kommensurabel sind, ist im Einzel-fall auszuloten. Das Spannungsfeld zwischen universalen und relativen Normen ist jeden-falls grundsätzlich in der Lage, auf beiden Seiten die Annahme zu verstärken, dass im jeweils Anderen das wirklich Fremde, wenn nicht gar das Feindliche begegnet. Ob ein Kompatibilismus, also die Vereinbarkeit des Nebeneinanders, in der praktisch-politischen Anwendbarkeit weiterhilft, sei dahingestellt: ein belastbarer Ausgleich zwischen universa-len und relativen Setzungen ist nur schwer erkennbar, da es auch im Miteinander der Kulturen nicht nur Normen geben kann, die man auf Zeit und Ort miteinander vereinbart. Dem Fremden ist so eine latente Krisenquali-tät eigen, die es im Alltagspraktischen zu überwinden gilt.
-
III. Das Fremde in den Kulturen
In den beiden ersten Kapiteln habe ich versucht, die Wahrnehmung des Fremden in Individuum und Gesellschaft selbst sowie des Fremden in der Begegnung zu analysie-ren: ein dynamisches wechselwirksames System von Selbst- und Fremdwahrnehmun-gen. Im Folgenden soll es um Kategorien gehen, die jenseits des Individuellen und Situativen die Wahrnehmung des Fremden maßgeblich beeinflussen. Es ist hinreichend bekannt, dass die Wahrnehmungen der eige-nen wie fremder Kulturen auch - und oft genug maßgeblich - von Stereotypen, sei es absichtlich, zufällig oder tradiert, bestimmt werden. Was ist typisch deutsch, was ist typisch russisch, was ist typisch muslimisch oder katholisch usw.? Stereotype haben heu-ristisch eine wichtige Funktion, insofern sie den ersten Schritt einer ordnenden Wahr-nehmung ermöglichen, die dann, wie oben ausgeführt, im dialogischen Miteinander hinterfragt werden sollten. Auf einer anderen Ebene agieren historische Fragestellungen, die sich dem Auf- und Niedergang sowie dem Miteinander von Kulturkreisen widmen. Diese ethnologisch-historischen Fragestel-lungen begleiten unsere westliche Zivilisati-on seit der Kodifizierung der Bibel, in den römischen Schriften zur Auseinandersetzung mit Karthago usw. und wurden seit der Auf-klärung von westlichen Philosophen und Historikern wieder aufgenommen. Die letzte große Analyse dieser Art stellt Samuel P. Huntingtons: ‚the clash of civilizations and the remaking of world order‘ (1996) [2] dar. Die Untersuchung ist fachlich nicht unum-stritten: das Konzept der Kulturkreise sei empirisch nicht hinreichend definiert, die Kausalverknüpfungen zwischen dem Streit
der Zivilisationen und deren Rückführung auf religiöse Werte und Normen sei nicht schlüssig, der Ausweis von Zentralstaaten in den Kulturkrisen nicht evident, Kulturkreise führten keine Konflikte oder Kriege usw., zudem entstamme das Buch der Zeit unmit-telbar nach dem Ende des West-Ost-Konfliktes und weise in Manchem eine stark inneramerikanische Sichtweise auf. Wie immer: die umfangreiche Studie ruft eine Urerfahrung des Menschen in Erinnerung, dass nämlich in der persönlichen oder sozia-len Begegnung mit dem Fremden immer auch große Kultur-Systeme einander begeg-nen. Die Brüche und Entfremdungen dieser Kulturkreise sind evident: Europa als westli-cher Kulturkreis, weitgehend überlappend mit dem orthodoxen, begrenzt im Osten von dem chinesischen und japanischen und im Süden von dem muslimischen Kulturkreis. Unbeschadet empirischer Befunde sind diese Kulturkreise – mal religiös, mal staatlich, mal kulturell begründet – ein heuristischer Ausgangspunkt in das Verstehen globaler Kultur und den ihr innewohnenden Antago-nismen. Das Verdienst Huntington ist es, den bekannten Ordnungskategorien von Ideolo-gie, Macht und Ökonomie die Kategorie ‚Kultur’ hinzugefügt zu haben, eine bedeu-tende Paradigmenergänzung zum Verständ-nis der Welt. Zugleich entwickelt Huntingtons Studie jedoch aufgrund ihrer vertrauten Fremdheitsmuster auch eine Scheinevidenz: Zum einen sind es nicht die Kulturkreise, die die Konflikte in Kriege und Migrationen umformen, sondern Staaten und Staatenbün-de und deren regionale und globale Interessen, die Konflikte der Kulturen sind dem-nach allenfalls als Begleitphänomen zu be-trachten. Zum anderen begegnen uns in An- betracht der beschleunigten Globalität der Prozesse und anhaltender Migrationen Kul-turkonflikte nicht nur in der Konkurrenz zu anderen Kulturkreisen, sie entstehen nicht mehr starr entlang der traditionellen Grenzen der Kulturen, sondern im Innern der Kultur-kreise und Staaten selbst. Die Migrationen sind sogar in der Lage, das Fremde zu ver-stärken, nämlich dann, wenn das Fremde sich in der Fremde in sich selbst verfestigt, um seine Identität zu wahren und sich als überlebensfähig zu verstehen. Desintegrative Prozesse sind so in allen Zuwanderungsge-sellschaften zu beobachten, sie können sich zum Stachel in der Gemeinsamkeit der Kul-turen entwickeln. Die Betrachtung von Kon-flikten zwischen den Kulturen, ihres Auf-stiegs und Niedergangs, hat seit der Antike zudem die Frage aufgeworfen, welche Be-deutung inneren Entwicklungen in den Kul-turen zukommt. Über Jahrtausende hinweg bestimmten seit der Antike kulturphiloso-phisch begründete Dekadenztheorien die Diskussion, die sich in verschiedenen Vari-anten biologischer Metaphern bedienten -Wachsen-Blütezeit-Niedergang –, so von einer Zyklentheorie ausgehen und zu einer moralischen Bewertung von Kulturentwick-lungen kamen: Kulturen verfremden sich gleichsam in sich selbst, so die Kernhypo-these, und steuern so ihrem Untergang ent-gegen. Andere Theorien verfolgen im Sinne der Moderne und auch in der Nachfolge von Karl Marx einen linearen Ansatz eines auf die Zukunft hin grundsätzlich offenen Pro-zesses, der im Wesentlichen von makroöko-nomischen Indikatoren, nicht von kulturalen, gesteuert wird.
Einen Zugang in diesem Sinne wählte zuletzt die weithin bekannte NASA-Studie von 2014. Die Forscher aus unterschiedli-chen Wissenschaftsbereichen fügten die be-kannten Veränderungsindikatoren in einen Algorithmus ein: soziale, ökonomische, öko-logische, politische, wissenschaftliche, kultu-rale Indikatoren. Sie kamen zu dem Ergeb-nis, dass hoch entwickelte, fortschrittliche, komplexe und kreative Zivilisationen fragil und aufgrund ihres Komplexitätsgrades nicht von Dauer sind. Dies gelte für alle bislang untergangenen Kulturen. Für unsere Gegen-wart benennen sie fünf Entwicklungsstränge, die für das Ende unserer Zivilisation verant-wortlich sein könnten: weltweites Bevölke-rungswachstum, Klimawandel, Wasserver-sorgung, Landwirtschaftsentwicklung und Energieverbrauch. Die aktuelle Überlastung der Ökosysteme und die zunehmenden Spal-tungen aller Gesellschaften in arm und reich seien ernstzunehmende Störungsprozesse, die zum Untergang unserer Zivilisation füh-ren können. An diesen Theorien sind zwei Aspekte bedeutsam: Zum einen gehen sie davon aus, dass es global wirksame Grund-lagen der Zivilgesellschaften gibt, die das Überleben der Menschheit sichern, und zwar unabhängig von den jeweiligen Kulturkrei-sen. Zum anderen, dass die kulturalen Aus-formungen der Zivilisationen, keinen we-sentlichen Indikator für deren Fortbestand darstellen. Die oft gehörte Annahme, die westlichen Gesellschaften seien aufgrund ihres charakterbildenden Individualismus und Hedo-nismus zum Untergang bestimmt, verweist offenbar absichtlich oder unabsichtlich auf fal-sche Begründungszusammenhänge.
Man könnte demnach die Kulturkreise als Kommunikationssysteme verstehen, die über lange Zeit und in großen Regionen das Zusammenleben der Menschen organisieren, prägen und ausformen. Begegnen wir dem Fremden einer anderen Kultur, bleibt jeweils zu fragen, ob wir uns einem Kommunikati-ons- und Verständnisproblem nähern oder ob wir hinter der Fassade des Fremden einem Grundbedürfnis des Überlebens oder einem Willen zur Sicherung politischer, wirtschaft-licher oder sozialer Macht begegnen. Schließlich könnten kulturelle Phänomene in all ihren Erscheinungsformen auch als Ver-deckung von Wirklichkeit im Sinne von Ide-ologie präsentiert und benutzt werden.
Quellenliste
Список литературы Das fremde in der kultur
- Adorno T.W. The authoritarian personality. Harper&Row,1950. 990 p.
- Huntingston Samuel P. The clask of civilizations. The debate. Simon&Schuster, 1997.