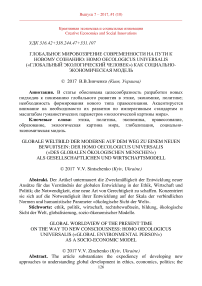Global worldview of the present time on the way to new consciousness: homo oecologicus universalis («global environmental person») as a socio-economic model
Автор: Zinchenko V.V.
Журнал: Креативная экономика и социальные инновации @cesi-journal
Статья в выпуске: 1 (18), 2017 года.
Бесплатный доступ
The article substantiates the expediency of developing new approaches to understanding global development in ethics, economics, politics; the need to form a new type of sense of justice. Attention is focused on the need for their development in accordance with imperative standards and the scale of the humanistic parameters of the «ecological picture of the world».
Ethics, politics, economics, legal consciousness, education, ecological picture of the world, globalization, socio - economic model
Короткий адрес: https://sciup.org/14239091
IDR: 14239091 | УДК: 316.42+338.244.47+331.107
Текст научной статьи Global worldview of the present time on the way to new consciousness: homo oecologicus universalis («global environmental person») as a socio-economic model
Kann es soetwas geben wie Rechte der Natur analog den Rechten des Menschen? Es gilt also, den Gerechtigkeitsbegriff auszudehnen, und zwar räumlich wie zeitlich. In räumlicher Hinsicht geht es um die Verantwortung gegenüber der gesamten menschlichen und natürlichen Mitwelt. Jede Beschäftigung mit den Begriffen Naturrecht und Menschenrecht wirft zunächst rechtsphilosophische Fragen auf. Solange wir uns an das positive (gesetzte) Recht halten, also Gesetzen und niedergeschriebenen Regeln folgen, bewegen wir uns auf sicherem Boden. Es geht also nicht ohne Nachdenken darüber, was alles zum Recht gehört. Wir können deshalb z.B. fragen, ob es richtig ist, die Natur insgesamt vom Recht auszuschließen, wie es das positive Recht bisher tut, oder ob nicht die Natur in das Recht irgendwie mit hineingehört. Und falls ja, welchen Inhalt sollten solche Rechte haben? Die Antworten darauf lassen sich nicht durch eine wissenschaftliche Analyse gewinnen, sondern nur mit Hilfe rechtsphilosophischer Reflexion .
Im Folgenden soll dargestellt werden, welche Schwierigkeiten zu überwinden sind und wie sich eine ökologische Ethik im Recht auswirkt. Die hier vorgetragene These ist, daß ein am Gerechtigkeitsideal orientiertes Recht beides verfolgen muß, die soziale und die ökologische Gerechtigkeit. In zeitlicher Hinsicht geht es um die Verantwortung nicht nur gegenüber der jetzt lebenden, sondern auch der künftigen Mitwelt. Ein solcherma ßen erweiterter Gerechtigkeitsbegriff entspricht dem Evolutionsgeschehen, deren Teil wir sind, und so ist denn auch die Überschrift dieses Kapitels zu verstehen: Menschenrecht und Naturrecht sind keine sich ausschließenden Kategorien, sondern Aspekte eines Rechtsverständnisses, das sowohl den Bedürfnissen des Menschen wie denen der Natur entsprechen will.
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations
Wenn es richtig ist, daß das mechanisch-dualistische Weltbild der Moderne einem Wirtschaft und ökologischen Weltbild weicht, dann stellt sich die Frage, ob die Wirklichkeit, welche die Grundlagen unserer Ethik, Politik und Recht geprägt hat, heute noch gültig sein kann und ob es nicht an der Zeit ist, die Grundlagen von Ethik, Politik und Recht zu überdenken [1, 43]. Ist es nach wie vor richtig, gesellschaftliche Ethik als allein auf das soziale Miteinander bezogen zu verstehen? Oder muß sie auch das “ ökologische Miteinander ” einbeziehen? Gibt es eine Verantwortung nur gegenüber der menschlichen Mitwelt oder besteht sie auch gegenüber der natürlichen Mitwelt? Falls ja, wie ließe sich eine solche umfassendere Verantwortung ethisch, politisch und rechtlich ausdrücken? Zu diesen Fragen gibt es keine eindeutigen Antworten. Ein gesellschaftlicher Konsens hat sich weder zur Ausgangslage, dem ökologischen Weltbild, gebildet noch zur Schlußfolgerung, der Wirtschaft und ökologischen Ethik. Über beides wird aber lebhaft gestritten, und Aufgabe jeder zukunftsorientierten Politik müßte es sein, diesen Fragen intensiv nachzugehen.
Galt noch bis in die achtziger Jahre hinein das unumstößliche Dogma, daß Naturwissenschaften, Ethik und Recht streng getrennt werden müßten, so sind die Grenzen heute fließender geworden. Disziplinen wie Systemtheorie, Verhaltensforschung, Sozialbiologie und Sozialökologie werden von der Rechtswissenschaft bereitwillig zur Kenntnis genommen. Sie kommen heute in den Lehrbüchern zur Rechtsphilosophie vor und nehmen einen immer größeren Raum ein, wenn es darum geht, die Zukunft des Rechts zu beschreiben. So werden naturwissenschaftliche Erkenntnisse, die eine enge Verbindung zwischen biologischen Prozessen und menschlichem Verhalten nahelegen, zum Anlaß genommen, Normsätze und Rechtserkenntnisse zu entwickeln. Nur beispielhaft seien die Arbeiten von Georg Henrik von Wright [2], Ota Weinberger [3], Gerhard Vollmer[4], Ernst-Joachim Lampe [5] und Hagen Hof [6] genannt.
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations
Es heute möglich, die verschiedenen Bereiche (natur- und human-) wissenschaftlicher Erkenntnis konkret aufeinander zu beziehen und Schlüsse für eine ökologische Ethik zu ziehen. Eine ökologische Ethik ist nicht nur konkret begründbar, sie kann auch die Rechts- und Staatsordnung entscheidend verändern. Eine solche Ordnung läßt sich als “ Ökologischer Rechtsstaat ” definieren, der im Folgenden kurz beschrieben wird.
Das, was neu sein wird, läßt sich nicht leicht auf einen kurzen Nenner bringen. Fest steht aber, daß es in der neuen Ordnung auf die Entwicklung der Vernunft ebenso wie auf die Entfaltung unserer sozialen Fähigkeiten und Gefühle ankommt. Soziale Gerechtigkeit, Selbstbeschränkung, Rücksichtnahme, Solidarität und eine Achtung vor dem Leben in all seinen Erscheinungsformen müssen zu unseren vordringlichsten Zielen und unseren wichtigsten Gütern werden. Die Grenzen der Vernunft und die Befangenheit in der individuellen Wahrnehmung der Welt müssen überwunden werden durch ein Einfühlen, eine Empathie in das, was das Leben, was die Natur erschaffen hat, was durch die Erscheinungen der Natur faßbar scheint, aber doch unfaßbar bleibt. In der neuen Ordnung haben alle Menschen das Recht, frei von sozialer Not und Unterdrückung zu leben. Desweiteren haben alle nichtmenschlichen Lebensformen das Recht auf Unversehrtheit und Weiterentwicklung.
Vorläufig ist der Begriff der « neuen Ordnung » nicht mehr als eine Metapher für eine Überlebensstrategie, deren Inhalte erst noch erarbeitet werden müssen. Was getan werden muß, ist aber jetzt schon klar: Jeder einzelne von uns muß überall dort, wo er Verantwortung trägt, sei es im privaten oder im beruflichen Bereich, außerdem seine persönliche Verantwortung für alle anderen Menschen, für die folgenden Generationen und für die Natur verstehen und annehmen.
Die Natur ist keine tote Materie, die außerhalb von uns existiert und mit der wir nicht viel zu tun haben, sondern wir sind ein Teil der Natur und die Natur ist ein Teil von uns. Dann können wir auch erkennen, daß ein Teil in uns danach ruft, gehört zu
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations werden und daß es dieser Teil in uns ist, der uns erlaubt, auch in seinem Namen zu handeln. Ein Handeln und Leben «im Namen der Natur» braucht eine Neuorientierung, die die Zerstörung der Natur beenden kann, denn die Zerstörung der Natur bedeutet für den Menschen gleichzeitig die Selbstzerstörung. Die Konsequenzen aus diesem Gedanken sind auf der individuellen wie auf der gesellschaftlichen Ebene vordringlich, zunächst einmal eine Änderung der Wahrnehmung von uns selbst und der Welt und eine Änderung unserer Grundhaltung zu uns und zu unserem Hiersein in dieser Welt.
Wir können uns nicht für eine neue Ethik entscheiden wie für ein neues Kleidungsstück. Sie entsteht vielmehr aus veränderten Einstellungen. Sind sie nicht vorhanden, kann es auch keine neue Ethik geben. Wenn eine ökologische Ethik als Verfassungselement gestaltende Kraft gewänne, wäre allerdings nur ein erster Schritt getan. Als Appell an unser Gewissen bliebe eine ökologische Ethik alleine völlig wirkungslos.
Wenn der Staat nicht aus sich selbst heraus zur Ökologisierung all seiner Aktivitäten fähig ist, braucht er Hilfe «von außen», d.h. von einem Verfassungsrahmen im weitesten Sinne, der den Staat auf eine Rolle festlegt, die realistisch ist, und auf Aufgaben, die langfristig-ökologisch ausgerichtet sind. Ein solcher ökologischer Ordnungsrahmen ist freilich nur denkbar, wenn er gesellschaftlich geformt wird. Er kann nicht verordnet werden, sondern nur beschrieben, erlebt, belebt, politisch propagiert und praktiziert werden. Zudem sind die Inhalte eines solchen Ordnungsrahmens nicht statisch und auch nur zu einem Teil rechtlich festzulegen. Lediglich einige Kernstücke lassen sich beschreiben, wie dies im Folgenden geschieht.
Der Wirtschaft und ökologische Rechtsstaat schließt sich gedanklich und historisch an den sozialen Rechtsstaat an. Blicken wir zurück auf die Entstehungsbedingungen des sozialen Rechtsstaates: Die Entwicklung des
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations
Rechtsstaates erfolgte über zwei Stufen. Zunächst wurden Freiheit und Gerechtigkeit Ziele des modernen (liberalen) Rechtsstaates. Nach der Weltwirtschaftskrise und den verheerenden Auswirkungen des zweiten Weltkrieges wurde die Verpflichtung von Gesellschaft und Staat auf sozialen Ausgleich im «sozialen Rechtsstaat» postuliert. Nun geht es um einen dritten Entwicklungsschritt: um den «Wirtschaft und ökologischen Rechtsstaat». Grundlage einer derartigen Neugestaltung sind die folgenden Erweiterungen des Rechtsstaatsbegriffes:
-
1. Der «Wirtschaft und ökologische Rechtsstaat» übernimmt die Verpflichtung zur Wahrung des ökologischen Gleichgewichts als Voraussetzung für jetziges und kommendes Leben.
-
2. Die Grundgesetze und die Organisation des Staates werden dahingehend modifiziert, daß die Grundrechte der Natur von ebenso großer Bedeutung und Wichtigkeit sind wie die Rechte einzelner Menschen oder Gruppen.
-
3. Durch eine «Wirtschaft-Ökologie-Verpflichtung» des Staates und seiner Bürger werden bestehende Grundfreiheiten wie Persönlichkeitsrecht, Forschungsfreiheit oder Eigentumsgarantie insofern eingeschränkt, daß eine Freiheitsausübung zu Lasten der Natur nicht mehr zulässig ist. Der Mensch hat kein Recht auf die freie Nutzung der Natur und auf die Ausbeutung ihrer Ressourcen. Technische Weiterentwicklung und Forschung ist nur dann erlaubt, wenn ihre soziale und ökologische Unschädlichkeit bewiesen ist. Die Beweislast liegt bei denjenigen, die die Forschung betreiben [7, 25].
Das Umdenken muß außerdem sofort stattfinden, denn aufgrund der jahrhundertelangen Ausbeutung der Natur und ihrer Ressourcen durch den Menschen ist ein Überleben des Menschen und vieler anderer Gattungen immer unwahrscheinlicher geworden. Es wird notwendig sein, dieses Umdenken weltweit durchzusetzen. Die wenigen Anstrengungen, die der Mensch in der Vergangenheit unternommen hat, um sein Überleben zu sichern, waren völlig unzureichend und
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations haben sich als untauglich erwiesen. Das Versagen dieser Mittel und Anstrengungen ist ursächlich darauf zurückzuführen, daß sie nicht umfassend und vorausschauend genug waren, und es ist eindeutig, daß Politiker und Regierungen mit ihrem starren Blick auf kurzfristige Ziele nicht in der Lage sind, etwas an den Überlebenschancen des Menschen und der ihn umgebenden Natur zu verbessern.
Das Umdenken, also die Wirtschaft und ökologische Revolution, ist möglich. Wir wissen heute, daß unser Fehler darin liegt, eurozentrisch, anthropozentrisch, mechanistisch und materialistisch zu denken und zu handeln. In diesen Kategorien zu denken bedeutet, daß wir uns von den wirklich wichtigen Zielen – wie dem Erhalt der Natur oder der Vermeidung von ökologischen Katastrophen – entfernen und jede Entwicklung nur unter dem Aspekt der Gewinnmaximierung und des vermeintlichen «Fortschritts» betrachten. Wenige Menschen haben dies bereits wirklich erkannt, trotz des in den letzten Jahren zunehmenden Interesse der Medien an Umwelt- und Tierschutz-Themen. Weltweit gibt es jedoch eine wachsende Zahl von Initiativen, Aufrufen und Publikationen, die nach einer grundlegend neuen ökologischen Ethik rufen und Menschen, die bereit sind, ihr Verhalten entsprechend ihrer inneren Einsicht neu auszurichten. Als massenhafte, in sich vernetzte Erscheinung kann sie dazu beitragen, weltweit zu einem neuen Umgang der Menschen miteinander und mit der Natur zu führen.
Es wäre verfehlt, wenn sich die zunächst wenigen Pioniere durch die geringe Resonanz auf ihre Forderung nach einer globalen ökologischen Revolution zur Resignation verleiten ließen. In vielen Ländern der Erde gibt es jetzt Gleichgesinnte, fordern Menschen nach politischen Zielsetzungen und Anstrengungen zur Erschaffung und Umsetzung einer ökologischen Ethik, deren Ziel die Umwandlung der ausbeuterischen Industriegesellschaften in Solidargemeinschaften mit einer klaren Hinwendung an ökologische Ziele ist.
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations
Wenn wir also davon ausgehen müssen, daß der (noch?) geltende Freiheitsbegriff der Bewußtseinsverfassung des homo oeconomicus occidentalis („des westlichen Wirtschaftmenschen“) entspricht, dann läßt sich ein zeitgemäßerer Freiheitsbegriff aus der Bewußtseinsverfassung des homo oecologicus universalis („des globalen ökologischen Menschen“) ableiten. Dieser Typus unterscheidet sich vom eingekapselten Ich westlich- ökonomischer Prägung dadurch, daß er sich seiner Zugehörigkeit zur sozialen und natürlichen Mitwelt bewußt geworden ist und seine Entfaltung im Zusammenwirken mit seiner Mitwelt anstatt in Gegnerschaft zu ihr anstrebt. Eine Möglichkeit, die angesichts der heute geradezu ins Auge springenden Unsinnigkeit isolierter Lösungen immerhin naheliegt. Wie real die Aussichten auf den Wandel zum homo oecologicus universalis sein mögen, ist dabei weniger von Bedeutung als seine zumindest gedachte Geltungskraft. Sie ist dann gegeben, wenn sich wenigstens ein relevanter Teil der heute lebenden Menschen mit ihm identifizieren kann. Dies scheint zumindest nicht mehr abwegig.
Wie also ließe sich der individualistisch-materialistische Kern des tradierten Freiheitsbegriff auflösen? Auf formaler Verfassungsebene besteht ohne weiteres die Möglichkeit, die Grund- und Freiheitsrechte neu zu fassen [8, 60]. Sie könnten als «Wirtschaft und ökologische Grundrechte» über die z.T. bereits anerkannten «sozialen Grundrechte» hinaus so erweitert werden, daß die Tatsache der ökologischen bzw. evolutiven Einbindung des Menschen in die ihn umgebende Natur zu entsprechenden Rücksichtnahmen führt, z.B. zur Beweislast dafür, daß Eigentum (an Land, Produktionsanlagen etc.) tatsächlich ökologieverträglich genutzt wird. Der dabei zugrundgelegte Freiheitsbegriff ist nicht negativ definiert als Freiheit und Abkehr «vom», sondern positiv als Freiheit und Hinwendung «zum» sozial-ökologischen Kontext [9, 37], in dem der Mensch steht. Die Freiheitsfrage muß neu gestellt und beantwortet werden, genauso wie seinerzeit die Frage nach des Menschen höchstem Gut gestellt und auf bürgerliche Weise für damalige
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations
Verhältnisse beantwortet wurde. Das Projekt der Aufklärung ist also noch keineswegs abgeschlossen; die Hauptarbeit ist noch zu leisten.
Wie also läßt sich die Organisation von Recht, Staat und Verwaltung sowie ihre Veränderung legitimieren? Nach dem hier zugrundegelegten systemtheoretischen Ansatz vollzieht sich «Legitimation durch Verfahren» [10, 137], d.h. durch die
Kommunikation im politischen Gesellschaftsprozeß, welche Machtausübung fortwährend rechtfertigt und so eine Identifizierung der Machtunterworfenen mit den Machtinhabern erlaubt. Im demokratischen Gemeinwesen geschieht dies in der Regel durch Abstimmungen, Öffentlichkeit und gewisse Mitspracherechte der BürgerInnen. Wie gut oder schlecht die so hergestellte Kommunikation ist, muß hier nicht interessieren. Wichtig ist nur, daß demokratische Verfahrensregeln sich gegenüber anderen – etwa diktatorischen, aristokratischen, charismatischen oder anarchischen – Verfahrensregeln als die verläßlicheren herausgestellt haben. Ihr Legitimationsgehalt ist somit höher, was bedeutet, daß für den Organisationsbereich gewählte Personen und existierende Mehrheiten für Legitimation sorgen und nicht ein «Rat der Weisen», wie respektabel die Weisen auch immer sein mögen.
Jede ethisch fundierte und auf Transformation zielende Politik würde freilich ihre Durchsetzungskraft verlieren, wenn sie nicht zugleich auch auf Konkretes, direkt Umsetzbares zielte. Unser dringlichstes Problem ist der täglich wachsende Energieeinsatz und Güterausstoß. Wichtigste Forderung ist daher: Die Grundlast des Industriesystems senken! Die Dynamik des ständig mehr produzierenden und aufbrauchenden Industriesystems wird erst dadurch gebrochen, daß die Produktionsmengen verringert und die Nutzung nicht erneuerbarer Ressourcen erschwert werden. Es gibt deshalb acht Mindesterfordernisse, über die wir keinerlei Zeit mehr verlieren sollten.
Die Produktion muß auf ein Maß reduziert werden, daß gesundem und vernünftigem Konsum entspricht. Dies ist nur dann möglich, wenn wir das Recht der
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations
Unternehmen (d.h. der Aktionäre und Konzernleitungen), über ihre Produktion ausschließlich vom Standpunkt des Profits und Wachstums zu entscheiden, drastisch einschränken.
Die Nutzung von fossilen Ressourcen für die Energieproduktion und den Energieverbrauch muß so besteuert werden, daß Energieeinsparung und Nutzung erneuerbarer Ressourcen die ökonomisch sinnvollere Alternative wird. Alle Methoden der konsumorientierten Gehirnwäsche in der kommerziellen und politi schen Werbung müssen verboten und ausreichende Mittel für die Aufklärung der Bevölkerung über unsere tatsächliche Lage bereitgestellt werden.
Ökologische Räte sind einzurichten, um die Regierung und Bürger in allen Angelegenheiten zu beraten, die ökologisches Wissen und das ganze System betreffende Kenntnisse erfordern. Konsumenten und Lohnabhängigen muß eine aktive Mitbestimmung über die Entscheidungen im politischen und industriellen Bereich eingeräumt werden. Frauen müssen die Hälfte aller verantwortlichen Positionen in Staat, Wirtschaft und Politik besetzen. Den Ländern der sogen. Dritten Welt sind Privilegien und Handelsbedingungen einzuräumen, die sie in die Lage versetzt, sich unabhängig und ökologisch-nachhaltig zu entwickeln. Das schulische und universitäre Bildungs- und Fortbildungsangebot und die dazugehörigen Institutionen müssen die systemischen Lebenszusammenhänge in Ihre Lehrpläne aufnehmen und vermitteln.
Muß dies aber absolut und uneingeschränkt gelten? Nein, denn der demokratische Verfassungsstaat läßt viele Ausnahmen zu. Die Ernennung von Richtern und Beamten, die Hinzuziehung von Sachverstand [11, 76-77] und sogar die Existenz von Grund- und Menschenrechten sind Beispiele dafür, daß Legitimation auch auf ganz undemokratische Weise zustande kommen kann. Demokratie ist also nicht sakrosanktes Heiligtum, sondern eine ständig fortzuentwicklende Staatsform, in die Minderheitenschutz, Opposition und Autorität qua Amt ganz selbstverständlich
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations hineingehören. Ohne optimierende Verfahren zur Berücksichtigung fundamentaler Anliegen wäre jede demokratische Ordnung langfristig zum Scheitern verurteilt. Ent scheidend für die Legitimität ist letztlich nur der Grad der Identifizierung mit der Organisation.
Dies zu betonen, ist deshalb so wichtig, weil demokratische Mehrheitsentscheidung und ökologische Weisheit durchaus in Konflikt miteinander stehen können, und zu fragen ist, ob es nicht neuer Organisationstrukturen braucht, die eine Herrschaft ökologischer Weisheit über eine derartige „ demokratische Mehrheitstyrannei ” erlaubt. Auf das damit zusammenhängende und immer wichtiger werdende Thema, wie die Gefahr einer Ökodiktatur zu bannen ist, kann hier nicht weiter eingegangen werden. Festzuhalten ist aber, daß die Gefahr einer Ökodiktatur nicht durch die Forderung nach Ökologisierung von Staat und Recht her aufbeschworen wird – wie von interessierter Seite gerne behauptet [12, 189], – sondern umgekehrt durch den fortwährenden Status Quo, der den Staat seiner eigenen Logik folgend zu diktatorischen Maßnahmen im Kampf um die noch verbleibenden Ressourcen treiben kann [13, 65]. Selbstverständlich können direkt-demokratische Partizipation, wie etwa Volksbegehren, und Treuhandvertretungen für die Natur, wie etwa ein Ökologischer Rat, Legitimität beanspruchen. Einer institutionalen Berücksichtigung von ökologischer Weisheit stünde der Demokratiegedanke sicher nicht im Wege [14; 15].
Zusammengenommen und in der Ausprägung der (über-) lebensnotwendigen ökologischen Ethik wäre die neue Aufgabe der Ökologische Rechtsstaat, wobei nochmals darauf hinzuweisen ist, daß der Staat, wie er uns derzeit begegnet, auf dessen Verwirklichung kein Monopol hat, sondern – angesichts seiner historisch bedingten Reduktion – nur eine, wenn auch wichtige, mitgestaltende Rolle spielen kann.
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations
Die vielleicht dringendste Voraussetzung einer Politik, die eine Neubestimmung von Staat und Wirtschaft anstrebt, ist ein neues Politikverständnis. Wir müssen Politik aus der Sphäre der Parteien und Parlamente herausholen und wieder dort verankern, wo sie mal ihren Platz hatte, nämlich auf den Plätzen, in den Straßen, in der Öffentlichkeit: «Politeia» als Angelegen heit aller und überall, nicht als Angelegenheit weniger in geschlossenen Zirkeln. Je besser es uns gelingt, die Institutionalisierung von Politik umzukehren und durch ein sehr archaisches Politeia-Bewußtsein zu ersetzen, desto größer unsere Chancen, endlich wieder gestalten zu können, wobei unsere Triebfeder nicht Macht sein darf, sondern die selbstlose, d.h. nicht psychisch verkrüppelte Liebe [15, 133].
Nicht um Reform geht es also, auch nicht um Reformation, sondern um Transformation. Wir brauchen eine neue Gestalt dessen, was den Gehalt von Staat und Wirtschaft ausmachen könnte. Übrigens wäre es auch nicht mit einer Revolution getan [16; 17]. Es würde uns nämlich nichts nützen, die Köpfe in den Regierungen, Banken und Direktorien einfach auszutauschen. Am Charakter ihrer Institutionen würde sich nichts ändern. Dem Tiger ist es völlig egal, wer ihn reitet. Nicht der Reiter, vielmehr der Tiger ist das Problem. Wir haben ihn mit der Flasche großge zogen und dürfen uns nicht wundern, daß er erwachsen wurde. Bleibt nur, den Tiger zu zähmen, was übersetzt bedeutet, uns selber in die Räson zu nehmen.
Wir sind somit auf uns selbst geworfen, und nur hier, in jedem Einzelnen von uns, kann entstehen, was institutionell zur evolutionsorientierten Wirtschaft und Staatlichkeit werden kann. Doch wie könnte dies je geschehen? In dem Augenblick, in dem unsere tiefsten ehrlichen Gedanken Form annehmen, geäußert werden und in Kommunikation mit den Gedanken an derer treten, treffen sie auf die gesellschaftlich vorherrschende Bewußtseinstruktur [18, 53]. Unsere Vorstellung sagt uns, es müßte alles ganz anders werden, die Wirklichkeit teilt uns mit, daß es nicht geht. Wenn sich an dieser Stelle nicht die Kraft unserer Vorstellung und unseres Wollens regen, hätte
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations tatsächlich alles keinen Sinn. Halten wir es also mit Hegel: «Wenn das Reich der Vorstellungen erst revolutioniert ist, kann auch die Wirklichkeit nicht lange stand halten» [19,202].
Wo steht in alledem der einzelne Mensch? Ist es nicht so, daß der Einzelne zwischen den übermächtigen Systemgebilden von Staat einerseits und Wirtschaft andererseits verloren geht? Und wäre nicht auch die Vision eines ökologischen Gemeinwesens nur das Große, Kollektive, in dem der Einzelne gar nicht recht vorkommt? Spätestens an solchen Fragen wird deutlich, wie sehr jede Vision einer ökologischen Zukunft von unserer individuellen Wahrnehmung abhängt. Die Vision ist nichts Abstraktes, sondern nur die Projektion unserer individuellen Wahrnehmung. Wenn wir Einzelne uns als von der Natur getrennt wahrnehmen, werden wir nie etwas anderes projizieren als eine von der Natur entfremdete Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Die natur- und selbstzerstörende Ordnung setzt sich schlicht fort – bis zum bitteren Ende. Entsprechend gilt dann aber auch umgekehrt: Mit einer veränderten individuellen Wahrnehmung können wir unser eigenes Verhalten und zugleich die Welt verändern! Die oben skizzierten sieben Mindestanforderungen müssen deshalb auf einen entscheidenen Nenner gebracht werden. Sie sind keine Anforderungen an “die” Gesellschaft oder “den” Staat. Sie sind Anforderungen an uns selbst. Sie lassen sich - gewissermaßen als persönliche Gebote – so formulieren:
-
1. Ich reduziere meinen Konsum auf ein gesundes, vernünftiges Maß (wodurch die Produktion zur Umkehr gezwungen wird).
-
2. Ich bin bereit, für Energieeinsparung und erneuerbare Energien zu zahlen (wodurch diese zur ökonomisch sinnvolleren Alternative werden).
3.Ich informiere mich selbst (wodurch Gehirnwäsche an Wirkung verliert).
-
4. Ich eigne mir ökologische Kompetenz an (wodurch die ökologische Inkompetenz der Politik bloßgestellt wird).
-
5. Ich übe mein Recht auf Mitsprache aktiv aus (wodurch Politik und Wirtschaft zum Hinhören genötigt werden).
-
6. Ich bin als Frau bereit, Verantwortung in Staat, Wirtschaft und Politik zu übernehmen; ich bin als Mann bereit zurückzustehen (wodurch es zur Geschlechtergleichheit in den Entscheidungszentralen kommt).
-
7. Ich verbünde mich mit den Menschen in der sogen. Dritten Welt gegen die eigene Regierung (wodurch echte Entwicklungshilfe zustande kommt).
-
8. Ich erkenne, daß wir in einer Zeit leben, die einen grundsätzlichen Wandel der Wahrnehmung, der Werte und der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen nötig macht und bin bereit, die Wandlungsschritte lernend selbst zu vollziehen .
-
9. Am Ende steht die schlichte Erkenntnis, daß der homo oecologicus universalis («des globalen ökologischen Menschen») nur dann zum gesellschaftlichen Leitbild wird, wenn wir den Menschen, der sich nicht nur selbst, sondern das Ganze erhält, in uns selbst erschaffen. Es ist eine Frage der politischen Kultur und nicht der richtigen Politikrezepte, ob die nötigen Änderungen kommen oder nicht. Nur in einer fruchtbaren politischen Kultur können die Visionen entstehen, die wir so nötig brauchen, wobei entscheidend ist, daß die Vision realistischer erscheint als der sogenannte Realismus der Politiker [20,419].
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations
Am Anfang der Vision sollte die Überzeugung stehen, daß das Industriesystem, diese Megamaschine mit ihrem Wirtschaftsmotor und dem staatlichen Schmieröl, nur insgesamt und nicht in Teilen überwunden werden muß. Bis zu einem gewissen Grade wird sich die Wirtschaft von selbst nach Kriterien richten, die einer naturnahen Kreislaufwirtschaft entsprechen. Und bis zu einem gewissen Grade wird auch der Staat diesen Kriterien folgen. Beide können den entscheidenden Durchbruch aber nur schaffen, wenn sich ihre Rahmenbedingungen ändern.
Die Aufgabe dieser Politik läßt sich mit einem einzigen Satz beschreiben. Sie muß dafür sorgen, daß die Rahmenbedingungen nicht mehr wie bisher der Logik der
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations real existierenden Marktwirtschaft folgen, sondern umgekehrt die Marktwirtschaft den Rahmenbedingungen, und zwar solchen, die den Menschen als Teil der Evolution begreifen und nicht in privilegierter, arroganter Abgehobenheit.
LITERATURVERZEICHNIS
-
1. Brugger W. Menschenwärde, Menschenrechte, Grundrechte. Baden-Baden: Nomos, 1997. 389 s.
-
2. Wright G.H. von. Erklenntnis als Lebensform. Wien: Böhlau, 1995. 495 s.
-
3. Weinberger O. Alternative Handlungstheorie. Wien:Böhlau, 1996. 310 s.
-
4. Vollmer G. Auf der Suche nach der Ordnung. Stuttgart: Schmetterling Verlag, 1995. 212 s.
-
5. Zusammenfassend zuletzt ders., Anthropologische Legitimation des Grundgesetzes, in: W.Brugger (Hrsg.), Legitimation des Grundgesetzes aus Sicht von Rechtsphilosophie und Gesellschaftstheorie. Berlin: Duncker/Humblot,1996. 189 s.
-
6. Hof H. Rechtsethologie. Heidelberg: Pendo Verlag, 2015. 195 s.
-
7. Ludtz P. Die Ideologie des Sozialdemokratismus.–Hamburg: Das Vorwarts Buch, 1993. 397 s.
-
8. Ditzhein W. Wirtschaft und Ökologische Grundrechte Zum Verhältnis zwischen individueller Freiheit und Natur. Baden-Baden: Nomos, 2008. 214 s.
-
9. Murswiek D. Freiheit und Umweltschutz aus juristischer Sicht, in: M. Kloepfer (Hrsg.), Umweltstaat als Zukunft. Bonn: J.H.W. Verlag, 2014. 256 s.
-
10. Luhmann N. Legitimation durch Verfahren. Darmstadt: Luchterhand, 1975. 231 s.
-
11. Kloepfer M. Droht der autoritäre Staat? // H.Baumeister (Hrsg.), Wege
zum ökologischen Rechtsstaat. Taunusstein: Neuer Isp-Verlag, 2002. 142 s.
-
12. Kockshott P.W., Kotrell A. Alternativen aus dem Rechner. Für sozialistische Planung und direkte Demokratie. Köln:PapyRossa Verlag, 2015. 267 s.
-
13. Touraine A. Thinking Differently. – Cambridge, Malden: Polity, 2009. 236 p.
-
14. Sintschenko V.V. Gesellschaft und Ethik im Kontext Wissenwirtschaft: über den Umgang mit ernsten Soziale Fragen//Soziale Wirtschaft. Bd.3. 6 (H.112). Suhrkamp Publishers &
Sozialforschung, 2016. S. 54-63.
-
15. Sintschenko V. Wissengesellschaft und eine Kulturgeschichte der Elemente (Soziale und philosophische Kontext der Ideen)// Sozialforschung und Wissengesellschaft (Ausgabe «Bildung und Demokratisierung»). № 70. 2017. S.127-132.
-
16 .Lafontaine O. Die Gesellschaft der Zukunft: Reformpolitik in einer veranderten Welt. Hamburg: SPD, 2008. 341 s.
-
17. Lafontaine O. Keine Angst vor der Globalisierung: Wohlstand und Arbeit fur alle. Berlin/Bonn: J.H.W.Dietz Verlag, 2014. 352 s.
-
18. Kurz R. Kollaps der Modernisierung. Fr.a.M.: Eichborn,2009. 288 s.
-
19. Reichelt H. Neue Marx-Lektüre. Zur Kritik sozialwissenschaftlicher Logik. Hamburg:Das Vorwarts Buch, 2008. 384 s.
-
20. Zinchenko V. Institutional Aspects of Globalization and Regionalization in the Context of the Transformation of Society// Journal of Social Sciences and Humanities. Vol. 1, No. 4, 2015. Р. 415-421.
Список литературы Global worldview of the present time on the way to new consciousness: homo oecologicus universalis («global environmental person») as a socio-economic model
- Brugger W. Menschenwürde, Menschenrechte, Grundrechte. Baden-Baden: Nomos, 1997. 389 s.
- Wright G.H. von. Erklenntnis als Lebensform. Wien: Böhlau, 1995. 495 s.
- Weinberger O. Alternative Handlungstheorie. Wien:Böhlau, 1996. 310 s.
- Vollmer G. Auf der Suche nach der Ordnung. Stuttgart: Schmetterling Verlag, 1995. 212 s.
- Zusammenfassend zuletzt ders., Anthropologische Legitimation des Grundgesetzes, in: W. Brugger (Hrsg.), Legitimation des Grundgesetzes aus Sicht von Rechtsphilosophie und Gesellschaftstheorie. Berlin: Duncker/Humblot,1996. 189 s.
- Hof H. Rechtsethologie. Heidelberg: Pendo Verlag, 2015. 195 s.
- Ludtz P. Die Ideologie des Sozialdemokratismus. -Hamburg: Das Vorwarts Buch, 1993. 397 s.
- Ditzhein W. Wirtschaft und Ökologische Grundrechte Zum Verhältnis zwischen individueller Freiheit und Natur. Baden -Baden: Nomos, 2008. 214 s.
- Murswiek D. Freiheit und Umweltschutz aus juristischer Sicht, in: M. Kloepfer (Hrsg.), Umweltstaat als Zukunft. Bonn: J.H.W. Verlag, 2014. 256 s.
- Luhmann N. Legitimation durch Verfahren. Darmstadt: Luchterhand, 1975. 231 s.
- Kloepfer M. Droht der autoritäre Staat?//H. Baumeister (Hrsg.), Wege zum ökologischen Rechtsstaat. Taunusstein: Neuer Isp-Verlag, 2002. 142 s.
- Kockshott P.W., Kotrell A. Alternativen aus dem Rechner. Für sozialistische Planung und direkte Demokratie. Köln: PapyRossa Verlag, 2015. 267 s.
- Touraine A. Thinking Differently. -Cambridge, Malden: Polity, 2009. 236 p.
- Sintschenko V.V. Gesellschaft und Ethik im Kontext Wissenwirtschaft: über den Umgang mit ernsten Soziale Fragen//Soziale Wirtschaft. Bd.3. 6 (H.112). Suhrkamp Publishers & Sozialforschung, 2016. S. 54 -63.
- Sintschenko V. Wissengesellschaft und eine Kulturgeschichte der Elemente (Soziale und philosophische Kontext der Ideen)//Sozialforschung und Wissengesellschaft (Ausgabe «Bildung und Demokratisierung»). № 70. 2017. S. 127 -132.
- Lafontaine O. Die Gesellschaft der Zukunft: Reformpolitik in einer veranderten Welt. Hamburg: SPD, 2008. 341 s.
- Lafontaine O. Keine Angst vor der Globalisierung: Wohlstand und Arbeit fur alle. Berlin/Bonn: J.H.W. Dietz Verlag, 2014. 352 s.
- Kurz R. Kollaps der Modernisierung. Fr.a.M.: Eichborn,2009. 288 s.
- Reichelt H. Neue Marx -Lektüre. Zur Kritik sozialwissenschaftlicher Logik. Hamburg:Das Vorwarts Buch, 2008. 384 s.
- Zinchenko V. Institutional Aspects of Globalization and Regionalization in the Context of the Transformation of Society//Journal of Social Sciences and Humanities. Vol. 1, No. 4, 2015. Р. 415 -421.