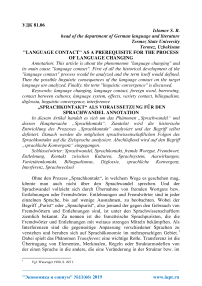Language contact as a prerequisite for the process of language changing
Автор: Islomov S.R.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Рубрика: Современные науки и образование
Статья в выпуске: 11 (66), 2019 года.
Бесплатный доступ
This article is about the phenomenon "language changing" and its main cause "language contact". First of all the historical development of the "language contact" process would be analyzed and the term itself would defined. Then the possible linguistic consequences of the language contact on the target language are analyzed. Finally, the term "linguistic convergence" is discussed.
Language changing, language contact, foreign word, borrowing, contact between cultures, language system, effects, variety contact, bilingualism, diglossia, linguistic convergence, interference
Короткий адрес: https://sciup.org/140246210
IDR: 140246210 | УДК: 81.06
Текст научной статьи Language contact as a prerequisite for the process of language changing
Gebrauch der aufnehmenden Sprache bewirkt. Dabei unterliegt die Übernahme der fremden Elemente etc. bestimmten Restriktionen, ausgelöst durch Aufbau und Bedürfnisse der aufnehmenden Sprache.2 Zu unterscheiden sind zwischen Ad-hoc-Transferenzen , die spontane Übertragungen von grammatischen Struktureigenschaften, Lexemen oder ganzen Phrasen einer Sprache in die andere bei aktuellen Sprachsituation und dauerhaften Transferenzen, reguläre sprachliche Übertragungen aller Art und sie sind besser bekannt unter dem Namen Entlehnungen.3 Nach Stepanova und Černyschova sind unter dem Terminus Entlehnung in der einschlägigen Literatur sowohl den Entlehnungsvorgang, d.h. die Übernahme fremden Sprachgutes, als auch das Resultat dieses Prozesses - das entlehnte fremde Sprachgut selbst zu verstehen.4
In der menschlichen Entwicklung sind die Sprachkontakte als eine Konstante zu fassen, insbesondere ab dem 16. Jahrhundert sind sie eine allgemeine Erscheinung der Kulturgeschichte. Sprachkontakt muss nicht notwendigerweise in von Angesicht-ins Angesicht Sprechsituationen vorkommen, der kommt heutzutage vielmehr über mediale Kanäle wie die Interferenzen aus der Modewelt oder aus der Computerbranche.5 Wie Arutjunov (1989) bezeichnet hat „(e)in Sprachkontakt ist nicht einfach ein Kontakt zwischen Zeichensystemen, sondern immer auch ein Kontakt zwischen Kulturen, denn mit Sprachen gestaltet der Mensch sein kulturelles Umfeld.6 Und das Aufeinandertreffen von Sprachen ist eine unbestrittene Voraussetzung für den Sprachwandel.7
Laut Weinreich (1953) kann Sprachkontakt aus drei Perspektiven behandelt werden:
-
a) aus der systemlinguistischer Perspektive – Untersuchung der
Auswirkung des Sprachkontaktes auf das Sprachsystem. Erscheinungen wie Codewechsel, Sprachmischung und Entlehnungen werden beschrieben;
-
b) aus psycholinguistischer Perspektive – Untersuchung der
Auswirkungen des Sprachkontakts auf das Individuum, Bilingualismus- , Mehrsprachigkeitsforschung;
-
c) aus soziolinguistischer Perspektive – das Verhältnis von
Sprache und Gesellschaft. Die Folgen des Sprachkontakts funktionale Aufteilung der Sprachen in der Gesellschaft (Diglossie oder Triglossie), Prozesse der Sprachverschiebung oder Sprachbewahrung.8
Grundsätzlich bei der Sprachkontaktphänomene sind zu unterscheiden zwischen den Binnenkontakten, in dem verschiedene autochtone Varietäten und Außenkontakten, in denen die autochtonen mit den umgebenden
Kontaktsprachen in Berührung kommt. Oder anders ausgedrückt steht der Begriff die Sprachkontaktphänomene als Oberbegriff für Varietätenkontakt im Sinne Binnenkontakt und Sprachkontakt im Sinne Außenkontakt, bezeichnet auch als Sprachkontakt im engeren Sinne.9
Riehl (2006) klassifiziert dann diese Unterscheidung weiter, in dem sie zunächst zwischen Erstsprache (L1) und der genetisch nicht verwandten Zweitsprache (L2).10 Demnach entsteht dann folgende Sprachkontaktkonstellationen:
-
a. Sprachkontakt zwischen Varietäten von verschiedenen Sprachen auf der gleichen Stufe (z.B. Dialekt von L1 und Dialekt von L2)
-
b. Sprachkontakt zwischen Varietäten verschiedener Sprachen auf verschiedenen Stufen (z.B. Basisdialekt von L1 und endogener Standard von L2).11
Wobei bezeichnet Riehl (2006) diese als interlingualer Varietätenkontakt.12
Auf die Frage wo die Sprachen miteinander in Kontakt treten, kann schlicht und einfach im Sinne eines geographischen Ortes Antwort gegeben werden. Weinreich (1977) vertritt die Meinung, dass die Sprachen sind dann in Kontakt getreten, wenn zwei oder mehr Sprachen von einem und derselben Person abwechselnd gebraucht werden. Demnach befindet sich der Ort des Sprachkontakts im Sprecher selbst. Wenn die Ort des Kontakts im metaphorischen Sinne verstanden wird, dann ist der Ort des Kontaktes im konkreten Sprechsituation zu suchen, und nicht etwa der Sprecher oder eine Gruppe von Sprechern.13 Wobei soll bei der Sprechsituation zwischen Bilingualismus und Diglossie unterschieden werden. Nach Fishman (1971) ist Bilingualismus individuelle Fähigkeit zwei Sprachen zu benutzen und ist Gegenstand der Psycholinguistik. Diglossie dagegen ist gesellschaftlicher Gebrauch von zwei Sprachen mit unterschiedlichen Funktionen.14 Die Diglossie kann in einer langfristigen Sprachkontakt sowohl als stabiler Zustand, als auch als labiles Übergangsstadium – Konflikt zwischen beherrschten und beherrschenden Varietäten – aufgefasst werden und es hängt je nach von der gesellschaftlichen Faktoren ab.15
Was ist dann sprachliche Konvergenz konnte zurecht die Frage gestellt werden. Die Meinungen, dass die Konvergenz die Folge des Sprachkontakts zu sehen ist, wird in der Literatur in der letzten Zeit in Frage gestellt. 16 Rosenberg bezeichnet die Konvergenz als kontaktbedingte sprachliche Entwicklung, in der die Varietäten bzw. die Sprachen mit einander in Wechselverhältnis eintreten,
entgegenlaufen, sich neutralisieren oder gemeinsamen Resonanzfall bilden.17 In dieser Hinsicht können beide Begriffe, sowohl die Sprachkontaktphänomene, als auch sprachliche Konvergenz als Synonyme bezeichnet werden, weil beide einen Prozess intendieren, deren Ergebnis bzw. Folge Dialektausgleich sowie Mischdialekte oder bei intensiver Sprachkontakt sogar Sprachwechsel bedeutet.18 Hier und im Folgenden werden diese beiden Begriffe inhaltlich gleichgestellt und der Begriff Sprachkontaktphänomene aus praktischen Gründen als Sprachkontakt bezeichnet.
Nach Andreas Dulson (1930) gibt es mehrere Faktoren, die bei der sprachlichen Konvergenz eine Rolle spielen: die Struktur der in Ausgleich tretenden dialektalen Varietäten, die sprachliche Norm der Standardsprache oder einer regionalen Verkehrsvarietät falls vorhanden, das soziale Prestige der Sprechergruppen, der Grad der sprachlichen Heterogenität innerhalb der Sprechergemeinschaft, die Spracheinstellungen der Sprecher zu den Varietätenmerkmalen und die inneren Entwicklungstendenzen des sprachlichen Wandels in den deutschen Varietäten. 19
Die wichtigsten Merkmale der sprachlichen Konvergenz bzw. Sprachkontakt sind die Neutralisation und Simplifikation im Sinne Abbau von morphologischen Strukturen. Generell wird die Ansicht vertreten, dass das Phänomen Neutralisation auf Sprachkontakt und das Phänomen Simplifikation dagegen intern bedingt dennoch sprachwissenschaftlich nicht erklärt werden kann.20
Die Folgen der dauerhaften Sprachkontakts sind im Einzelnen phonetisch-phonologische, lexikalische, morphologische und syntaktische sowie phraseologische Einflüsse.21 Die lexikalischen, morphologischen und syntaktischen Aspekte werden im Folgenden eingehender behandelt.
Der Einfluss einer Sprache bei den Sprachkontaktphänomene wird am schnellsten und am offensichtlichsten auf der lexikalischen Ebene bemerkbar. Mit den lexikalischen Lücken verbundene Sprachwechsel ist sprachökonomisch bedingt und stellt damit in den einzelnen Sprachen eine natürliche Erscheinung im Sprachgebrauch dar, die dem Sprecher eigentlich gar nicht bewusst ist. Darüber hinaus sind die lexikalischen Transfers klassische und bekannte Beispiele für die Füllung von Nominationslücken bei den Sprechern, deren Sprachkompetenz nicht voll ausgebaut und nicht stabil ist.22
Als Folge des dauerhaften Sprachkontakts sind dann auf der lexikalisch-semantischen Ebene die Lehnwörter, Bedeutungswandel des Erbwortschatzes (Bedeutungsarchaisierung Bedeutungsverengung und Bedeutungserweiterung), die Lehnübersetzungen, die geistig an die Zielsprache angepasst werden und die
Lehnübersetzungen von Phrasen. Den größten Anteil im entlehnten Wortschatz betragen Substantive, gefolgt von Verben, Adjektiven und Adverbien.23
Sowohl morphologische, als auch syntaktische Sprachkontaktphänomene sind nicht so häufig und auffällig wie dies bei der lexikalisch-semantischen Ebene der Fall ist.24 Dabei spielen offensichtlich jeweils die typologischen Unterschiede und Ähnlichkeiten der Kontaktsprachen. Tritt das Deutsche zum Beispiel als stark reflektierende Sprache mit dem wenig flektierenden englischen Sprache in Kontakt, ist zu erwarten, dass die Formen von weniger flektierenden Sprache in die stärker flektierende Sprache übertragen werden. So wird aus dem Beispiel „ ein Sydneyer Strand“ – „ein Sydney Strand“ .25 Rosenberg (2003) ordnet diese Art von sprachlichen Kontakt sogar in eine eigene Kategorie und bezeichnet diese als typologische Konvergenz. Demnach sind die morphologischen Phänomene wie Kasusverfall oder Präteritumschwund die Segmente der langfristigen Entwicklung von synthetischen zu analytischen sprachlichen Strukturen.26
Weitere Entlehnungen in diesem Sinne im Einzelnen sind:
-
- Wandel der nicht-reflexiven Verben in reflexive;
-
- Veränderung des grammatischen Geschlechts;
-
- Weglassung des Artikels vor russischen Entlehnungen;
-
- Übergang in die Gruppe der Pluraliatantum;
-
- Synonymer Gebrauch der Vergangenheitsformen Präteritum, Perfekt und Plusquamperfekt;
-
- Teilweise Veränderung der Wortfolge nach russischen Mustern; die Sonorisierung;
-
- die Nasalisierung;
-
- der Rothazismus;
-
- die Reduktion der Kasusmorphologie.27
Alle diese Veränderungen haben aber keinen stabilen Charakter und können nahezu sporadisch bzw. temporär bezeichnet werden. Allerdings selbst der Standpunkt, dass die morphologische Konvergenz als Folge des Sprachkontaktes zustande kommt, wird in der Literatur von manchen Autoren in Frage gestellt.28
Список литературы Language contact as a prerequisite for the process of language changing
- Berend, Nina: Sprachliche Anpassung. Eine soziolinguistische-dialektologische Untersuchung zum Russlanddeutschen, Tübingen 1998
- Eichinger, Ludwig M.: Einleitung. Sprachkontakte. Konstanten und Wandel, in: Eichinger / Raith (Hrsg.): „Sprachkontakte. Konstanten und Variablen", Bochum 1993, S. 7-16
- Goldbach, Alexandra: Deutsch-russischer Sprachkontakt. Deutsche Transferenzen und Code-switching in der Rede Russischsprachiger in Berlin. Berlin 2005
- Haarmann, Harald, Weltgeschichte der Sprachen. Von der Freiheit des Menschen bis zur Gegenwart, München 2006
- Islomov Sanjar: Interferenz beim Erwerb von Deutsch als Fremdsprache bei den Studierenden mit usbekischer Muttersprache/ Исломов С.Р. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. - 2018 - №06. - p. 95-97
- Kerstin, Anders: Einflüsse der russischen Sprache bei deutschsprachigen Aussiedlern: Untersuchungen zum Sprachkontakt deutsch-russisch; mit Transkriptionen aus fünf Gesprächen, Hamburg 1993
- Mattheier, Klaus J.: Theorie der Sprachinsel. Voraussetzungen und Strukturierungen, in: Berend, Nina / Mattheier, Klaus J. (Hrsg.): „Sprachinselforschung. Eine Gedenkschrift für Hugo Jedig", Frankfurt a.M. 1994, S. 333-348
- Riehl, Claudia Maria: Sprachwechselprozesse in deutschen Sprachinseln Mittel- und Osteuropas. Varietätenkontakt und Varietätenwandel am Beispiel Transkarpatiens, in: Berend / Knipf-Komlόsi (Hrsg.): „Sprachinselwelten. Entwicklung und Beschreibung der deutschen Sprachinseln am Anfang des 21. Jahrhunderts", Frankfurt a.M. u.a. 2006, S. 189-204
- Rosenberg, Peter: Varietätenkontakt und Varietätenausgleich bei den Russlanddeutschen: Orientierungen für eine moderne Sprachinselforschung, in: Berend / Mattheier (Hrsg.): „Sprachinselforschung. Eine Gedenkschrift für Hugo Jedig", Frankfurt a.M. 1994, S. 123-164
- Rosenberg, Peter: Vergleichende Sprachinselforschung: Sprachwandel in deutschen Sprachinseln in Russland und Brasilien, in: Linguistik online 13, 1/03, http://www.linguistik-online.de/13_01/rosenberg.html, 2003, Zugriff 27.12.2008
- Rosenberg, Peter u.a.: Regularität und Irregularität in der Kasusmorphologie deutscher Sprachinselvarietäten (Russland, Brasilien): intralinguale, interlinguale, typologische Konvergenz. Vortrag in dem Workshop „Prozesse der Regularität und Irregularität in Phonologie und Morphologie" an der WWU Münster, Germanistisches Institut, 19-20.06.2009, in: http://www.kuwi.euv-frankfurt-o.de/de/lehrstuhl/sw/sw1/mitarbeiter/rosenberg/index.html, Zugriff 01.08.2009
- Stepanova M.D./ Černyschova I.I.: Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. Moskau 2003
- Stroh, Cornelia: Sprachkontakt und Sprachbewusstsein. Eine soziolinguistische Studie am Beispiel Ost-Lothringens, Tübingen 1993
- Wiesinger Peter: Deutsche Sprachinselforschung, in: Althaus u.a. (Hrsg.): „Lexikon der Germanistischen Linguistik", Tübingen 1980, S. 491-500.